Ein neuer Anlauf für ein Gesetz – Hoffnung oder Gefahr für die Selbstbestimmung?
2023 scheiterten zwei konkurrierende Gesetzentwürfe – ein restriktiver Vorschlag aus der Gruppe um Lars Castellucci (SPD) und ein liberaler von Abgeordneten wie Katrin Helling-Plahr (FDP) und Renate Künast (Grüne). Nun will eine neue, parteiübergreifende Initiative – unter anderem mit Lukas Benner (Grüne) und Matthias Mieves (SPD) – einen dritten Versuch unternehmen: Ein einzelner, mehrheitsfähiger Gesetzentwurf soll es diesmal richten.
Doch was steht auf dem Spiel – und was haben wir aus dem Scheitern der Vergangenheit gelernt?
Zwischen Freiheit und Schutz: Das Spannungsfeld
Das Bundesverfassungsgericht hat klar formuliert: Der Staat darf die assistierten Sterbehilfe regulieren, muss es aber nicht. Er darf Verfahren zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit definieren – aber keine moralisch motivierte Hürde errichten, die das Grundrecht aushöhlt. Das bedeutet: Es geht nicht um ein „Ob“, sondern um ein „Wie“ einer möglichen gesetzlichen Regelung.
Der Kern jeder gesetzgeberischen Überlegung muss daher die Freiverantwortlichkeit sein: Wer will aus freien Stücken, wohlüberlegt und ohne äußeren Druck aus dem Leben scheiden – und wer ist möglicherweise psychisch erkrankt, verzweifelt oder beeinflusst? Besonders bei Menschen mit Depressionen, Demenz oder multiplen Belastungen ist diese Unterscheidung heikel – aber entscheidend.
Das Problem des Status Quo
Seit dem Urteil von 2020 ist Sterbehilfe in Deutschland legal – aber für Viele ist es ein Graubereich, den es letztlich nicht gibt. Die praktische Folge: Wer Hilfe sucht, ist auf private Organisationen oder einzelne Ärzt:innen angewiesen. Einige gemeinnützige Vereine bieten Begleitung an, aber nur für Mitglieder. Kommerzielle Anbieter verlangen mehrere tausend Euro. Wer keinen Zugang findet, bleibt oft alleine – oder bricht den Wunsch nach einem würdigen Sterben ab - und dies oft traumatisiert und weiter entwürdigt.
Das ist für viele, die sich seit Jahren mit dem Sterben beschäftigen, untragbar: Sie brauchen keine „Beratung“ oder "Gro0e Gesetzliche Regelung", sondern eine sachliche, würdige Begleitung – mit dem Fokus auf Freiheit, nicht Abschreckung.
Aufklärung ist so wichtig
Aufklärung so wichtig, da es nur kaum Graubereiche gibt, wir haben klare Grenzen des Erlaubten – eine Aufklärung zu der ich mit meinem Blog und auch durch Beiträge wie diesen und die weiterführenden Artikel und Q&A-Serien, die du über die verlinkten Themen und den Tag Q&A findest, beitragen möchte.
- Q&A: Warum Sterbehilfe und Freitod? Ein Plädoyer für Freiheit und Würde
- Q&A - Was stellen Sie sich vor, wenn es kein neues Gesetz, wie den §217 StGB geben soll?
- Q&A - Wieso ich gegen die Gesetzentwürfe im Juli 2023 war
Warum frühere Entwürfe scheiterten – und was sich ändern muss
Der Castellucci-Entwurf von 2023 zielte auf eine enge Strafrechtsregelung, die auf Abschreckung und Kontrolle setzte. Zwei Pflichttermine bei Psychiatern innerhalb eines engen Zeitfensters, zusätzliche Wartefristen, Dokumentationspflichten, Zugangsbeschränkungen in Pflegeheimen – all das hätte besonders alte oder schwerkranke Menschen faktisch vom Recht auf Sterbehilfe ausgeschlossen. Er war ein Rückschritt in religiöser Verpackung – mit einem Menschenbild, das Schutz über Selbstbestimmung stellte.
Der liberale Entwurf der Gruppe um Helling-Plahr/Künast war hingegen deutlich näher an den Maßgaben des Verfassungsgerichts. Er setzte auf eine freiwillige, ergebnisoffene Beratung und eine klare, aber milde Regelung – jedoch fehlte es an einem belastbaren Verfahren zur Prüfung der Freiverantwortlichkeit, besonders in schwierigen Fällen.
Wer mehr zum Lars Castellucci Entwurf oder mehr zum liberale Entwurf der Gruppe um Katrin Helling-Plahr und Renate Künast wissen möchte kann die Hyperlinks der Namen anklicken oder unten den Tags folgen
Ein neuer Kompromiss? Hoffnung auf eine ausgewogene Lösung
Die neue parlamentarische Initiative setzt auf einen einzigen, gemeinsamen Entwurf. Ziel: Eine klare, menschliche und verfassungsfeste Regelung, die den Zugang zur Sterbehilfe absichert und gleichzeitig vulnerable Menschen schützt.
Einige Leitgedanken zeichnen sich ab:
-
Keine Rückkehr zum Strafrecht: Eine neue Version von § 217 StGB wird es nicht geben – und das ist gut so - das habe ich bereits vor ziemlich genau 3 und 4 Jahren dargelegt, dass eine Neuauflage des §217 StGB nicht zielführend ist.
-
Psychologische und ärztliche Begutachtung – aber mit Augenmaß: Ein „Vieraugenprinzip“ zur Feststellung der Freiverantwortlichkeit ist sinnvoll, darf aber nicht zum unüberwindbaren Hindernis werden.
-
Dokumentation und Beratung: Nicht im Sinne von Umerziehung oder Abschreckung, sondern als transparente Begleitung.
-
Berücksichtigung individueller Lebenslagen: Auch Menschen mit chronischen Leiden, Lebenssattheit oder psychischen Krankheiten müssen berücksichtigt werden – ohne pauschalen Ausschluss.
Die parlamentarische Realität
Ein Entwurf kann nur Erfolg haben, wenn sich genügend Abgeordnete hinter ihn stellen. Die AfD, die bereits 2023 beide Vorschläge blockierte, wird voraussichtlich wieder ablehnen. Das bedeutet: Von den übrigen 479 Abgeordneten müssten mindestens 316 zustimmen – und das nur, wenn es keinen Gegenentwurf gibt. Ein gescheiterter neuer Versuch könnte den Zustand der Unsicherheit weiter zementieren - da es nun einmal viele der wichtigen Helfer wie Ärzte gibt denen die aktuelle doch recht klare Gesetzeslage nicht ausreicht um sich zur Hilfe zur überwinden, zumal die Ärztekammern auch eher von einem streng religiösen Leitbild getrieben sind – und bei einem nicht konformen Gesetz , wie es die Lars Castellucci Gruppe erdachte, wieder ein erneuter Gang nach Karlsruhe die Folge wäre.
Redebeiträge zu den vorangegangen Debatten zu den damaligen Gesetzentwürfen habe ich hier verlinkt.
Fazit: Selbstbestimmung braucht Mut – auch im Parlament
Ein Gesetz zur Sterbehilfe darf nicht Ausdruck von Bevormundung sein.
Es braucht Vertrauen in den Menschen, der sich – mit Unterstützung, Aufklärung und in vollem Bewusstsein – für sein Lebensende entscheidet.
Der Staat darf begleiten, informieren, schützen – aber nicht moralisieren oder durch Restriktionen verdrängen, was ein individuelles, durchdachtes Lebensende sein kann.
Nicht jeder, der stirbt, ist krank. Nicht jeder, der leidet, braucht Therapie.
Der Wunsch zu sterben - er Wunsch eines Freitodes - ist immer, ich hatte zumindestens noch nicht das Gegenteil erlebt und begleitet, welcher nicht das Ergebnis von intensivsten Nachdenken, Würde und Autonomie war.
Diesen Menschen gerecht zu werden, ist Aufgabe des Gesetzgebers – NICHT, ihnen durch neue Schranken das Leben und Sterben zusätzlich zu erschweren.
Zusammenfassend die Ziele, Aussagen von einigen Politikern
Eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe soll geschaffen werden, die mehrheitsfähig ist.
Die neue Regelung soll individuelle Selbstbestimmung ermöglichen, Missbrauch verhindern und vulnerable Menschen schützen.
Ein einziger Kompromissentwurf soll eingereicht werden, um ein Scheitern wie 2023 zu verhindern.
Interfraktionelle Arbeitsgruppe aus SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU (ohne AfD) arbeitet an einem neuen Gesetzesentwurf.
Fokus auf Kompromiss, der zwischen liberaler Selbstbestimmung und Schutzkonzept vermittelt.
Verzicht auf strafrechtliche Regelung (wie §217 StGB in der alten Fassung).
Begleitmaßnahmen wie sozial-psychologische Beratung und ärztliche Zweitmeinung (Vieraugenprinzip) sind in Diskussion.
Ziel ist, noch in dieser Legislaturperiode eine gesetzliche Grundlage zu schaffen.
Aussagen der Politiker
Matthias Mieves (SPD): Will Gräben zwischen liberalen und restriktiven Positionen überbrücken.
Lars Castellucci (SPD): Akzeptiert Urteil des Bundesverfassungsgerichts; will klare, ausgewogene Regelung; "Suizid darf nicht als normal erscheinen".
Lukas Benner (Grüne): Zeigt sich zuversichtlich für einen Kompromiss; betont Handlungsdruck.
Kirsten Kappert-Gonther (Grüne): Plädiert für Regulierung als Teil der Suizidprävention; Schutzkonzept im Fokus.
Prof. Helmut Frister (Ethikrat): Begrüßt Verzicht auf Strafrecht; sieht erhöhte Erfolgschancen für gesetzliche Regelung.
Prof. Bettina Schöne-Seifert (Medizinethikerin): Fordert "sanfte" Regelung, um Ärzte zur Mitwirkung zu ermutigen.
Warum beteiligt sich die AfD nicht?
Die AfD war weder 2023 noch jetzt in die interfraktionellen Gruppen eingebunden oder wollte ich einbringen.
Die AfD verweigerte sich 2023 geschlossen beiden Gesetzentwürfen (liberal und restriktiv) mit "Nein"-Stimmen.
Durch diese blockartige Ablehnung trug sie maßgeblich zum Scheitern beider Entwürfe bei.
Niemand arbeitet bewusst mit der AfD zusammen, was bedeutet, dass ein Kompromiss ohne ihre Stimmen eine ausreichend große Mehrheit benötigt (mind. 316 der verbleibenden 479 Abgeordneten).
Zu AfD und deren Haltung muss man sich deren Reden im Bundestag anhören, aus der Debatte zum Thema Suizidhilfe & Gesetzentwürfe





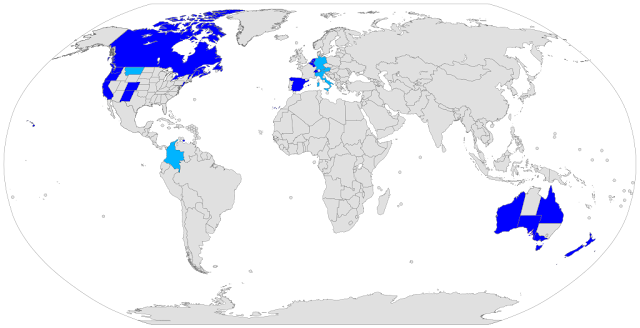
Comments
Post a Comment